Träumen Androiden von künstlichen Schafen?
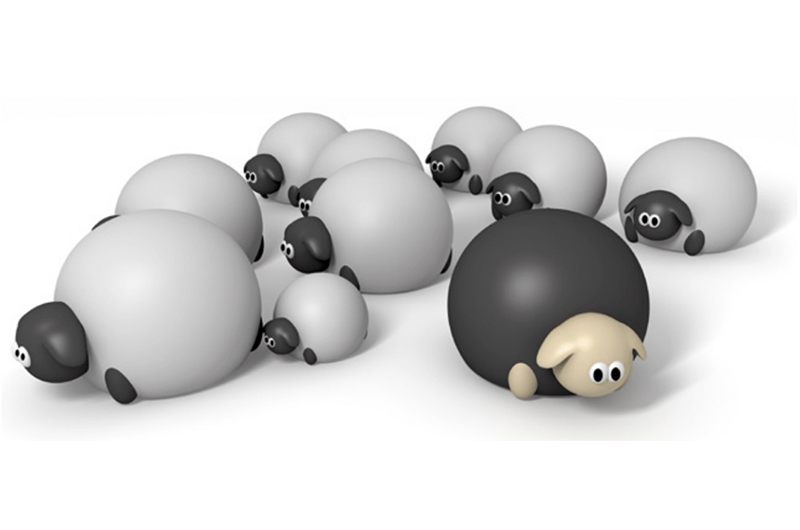
Träumen Androiden von künstlichen Schafen?
Wer diesen Buchtitel nicht kennt, kennt vielleicht „Blade Runner“, den Film von Ridley Scott, der auf diesem Buch basiert. Es gibt viele Vorbehalte gegen Science-Fiction. In den meisten Fällen ist die Zukunft, die da beschworen wird, dystopisch, d. h. eine negative Vision (im Gegensatz zu eutopisch bzw. utopisch). Das Buch von Philip K. Dick, einem der besten amerikanischen Science-Fiction-Autoren des 20. Jh.s, macht da keine Ausnahme. Erschienen ist es bereits 1968, und man kann nur staunen über den Weitblick des Autors. Die Fragen, die er darin aufwirft, sind erst jetzt richtig brisant geworden, da die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) so rasante Fortschritte macht. Die mit KI ausgestatteten Maschinen sind uns Menschen dicht auf den Fersen; manche Wissenschaftler warnen sogar davor, dass sie uns noch überholen werden. Es ist dringend geboten, die Position des Menschen neu zu bestimmen.
Was macht den Menschen aus?
Wir befinden uns in der Zeit nach dem „großen Krieg“, einem Atomkrieg, der die Erde fast unbewohnbar gemacht hat. Die Menschheit hat sich selbst abgeschafft. Nahezu alle Überlebenden sind auf den Mars ausgewandert. Um ihnen die Besiedlung zu erleichtern, wurden Superroboter konstruiert, eine neue Art von Sklaven. Sie sind äußerlich nicht von Menschen zu unterscheiden, sind mit einer überragenden Intelligenz, aber auch einem „Verfallsdatum“ ausgestattet, und dürfen die Erde nicht betreten. Aber der Mars ist nicht das Paradies, das man den Auswanderern vorgaukelt. Auch deshalb kommt es immer wieder zu Sklavenaufständen von Androiden, die sich gegen ihre Herren auflehnen, zur Erde zurückkehren und sich hier unter die Menschen mischen. Auf der Erde zurückgeblieben sind vorwiegend sogenannte Untermenschen wie das „Spatzenhirn“ John Isidore, die vom nuklearen Fallout stark geschädigt worden sind, und Kopfjäger, professionelle Killer, die die eingeschlichenen Androiden jagen.
Einer der Androiden-Jäger ist Rick Deckard, dessen Name nicht zufällig an den französischen Philosophen René Descartes (1596–1650) erinnert. Für Descartes ist der Mensch das zweifelnde Wesen. Der Mensch zweifelt an der Realität, an den Anderen, die diese Realität gestalten, sogar an sich selbst und an der eigenen Existenz. Aber, so sagt Descartes, es gibt eine Bewusstheit, die diese Zweifel formuliert, und „das bin ich“. Androiden kennen den cartesianischen Zweifel nicht. Für Philip K. Dick definiert sich der Mensch durch seine Komplexität und seine Zweideutigkeit. Menschlich sein heißt, sich zu widersprechen, keine unverrückbaren Gewissheiten zu haben, keine Antworten zu haben, die ein für alle Mal und überall gleichermaßen gelten.
Wenn wir Rick Deckard kennenlernen, ist er noch voll und ganz von seiner Mission überzeugt; die Kopfgeldprämien, die er für jeden ausgeschalteten Androiden, kurz „Andy“ genannt, erhält, erleichtern ihm seine Überzeugung.
Falls die Begeisterung doch einmal nachlässt, hängt er sich an seine „Stimmungsorgel“, auf der er den gewünschten Gemütszustand einstellen kann, z. B. sexuelle Erregung oder professionelle Sachlichkeit. Hier drängt sich zum ersten Mal die Frage auf, worin er sich dann noch von den menschenähnlichen Robotern unterscheidet, die er jagt. Deckard hört eine Androidin in Mozarts „Zauberflöte“, welche „besser als Elisabeth Schwarzkopf, Lotte Lehmann oder Lisa della Casa“ singt, die er noch aus alten Aufnahmen vor der Zeit des großen Krieges kennt.
Wem käme da nicht Olympia aus der Oper „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach in den Sinn? Olympia ist ein singender Automat, und Hoffmann verliebt sich in sie. Rick Deckard ist wie sein Schöpfer Philip K. Dick ein Opernliebhaber. Er fühlt sich zu der Sängerin hingezogen. Trotzdem wird sie „eliminiert“. Rick kommen die ersten Zweifel. War das wirklich nötig? Ja, versucht er sich zu beruhigen, Andys sind Maschinen. Sie können kein Mitgefühl, keine Empathie empfinden. Aber, fragt er sich plötzlich, was tue ich denn anderes? Und dann die Unsicherheit: Woher weiß ich, dass ich ein Mensch bin und keine Maschine?
Menschen empfinden Mitgefühl. Wirklich?
In der Philosophiegeschichte hat diese Frage eine lange Tradition: Was kann ich wissen? Woher weiß ich, dass ich ich bin und kein anderer? Ganz einfach durch meine Erinnerung … Genau.
Das, was wir „Ich“ nennen, ist vor allem eine Konstruktion der Erinnerung.
Und wenn die Erinnerung nun nicht meine wäre, sondern – künstlich? Hier befinden wir uns wieder im Roman, wo dem Gehirn von Androiden eine künstliche Erinnerung mitgegeben wird. In der Wirklichkeit sind wir noch nicht so weit, wir machen das selbst. Menschen verfügen über klare „Erinnerungen“ an Geschehnisse, die nie passiert sind. Und dass wir unsere Erinnerungen im Nachhinein manipulieren und „umschreiben“, kann man bei einiger Aufmerksamkeit an sich selbst feststellen. Sehr poetisch hat diesen existenziellen Zweifel der chinesische Philosoph und Dichter Dschuang Dsi (um 365–290 v. Chr.) ausgedrückt: „Ich schlief und träumte, ich sei ein Schmetterling. Ich erwachte und sah, dass ich ein Mensch bin. Aber woher weiß ich, dass ich kein Schmetterling bin, der träumt, er sei ein Mensch?“
Auf dem Boden dieses Zweifels keimt nun das Mitgefühl auch für nichtmenschliche Lebensformen. Tiere gehören dazu. Ein Tier zu haben, bedeutet, sich als Mensch zu fühlen. In der apokalyptischen Romanzeit gibt es nicht mehr viele echte, sondern fast nur noch künstliche Tiere. Sie sehen nicht nur genauso aus wie echte, sie verhalten sich auch so, reagieren auf ihren Besitzer und kennen seine Eigenarten. Der Besitzer entwickelt seinerseits eine emotionale Beziehung zu dem künstlichen Tier.
Zwei Anmerkungen seien hier erlaubt: Für René Descartes galten Tiere ohnehin als eine Art Maschine, deren Verhalten in Analogie zu den Gesetzen der Mechanik erklärt werden konnte; ihre Äußerungen waren für ihn nur Reaktionen ohne Bewusstseinsinhalte. Tiere verfügen, laut Descartes, nicht über die „geistige Substanz“ (res cogitans), die den Menschen auszeichnet.
Wenden wir nun den Blick in die Echtzeit, nach Japan. Dort hatte die Firma Sony Ende der 90er-Jahre den Computerhund Aibo herausgebracht und trotz sehr guter Absatzzahlen die Produktion 2006 bzw. die der Ersatzteile etwas später eingestellt. Damit hatte Sony viele Menschen zuerst glücklich gemacht und dann in bodenlose Verzweiflung gestürzt: Wo sollten sie Ersatzteile herbekommen, um ihren Hund „am Leben“ zu erhalten? Die „toten“ Hunde wurden sogar in einer buddhistischen Begräbniszeremonie „ausgesegnet“. Ende 2017 hat Sony die Produktion wieder aufgenommen.
Die neue Version von Aibo ist mit KI ausgestattet, die es dem Hund ermöglicht, etwa die Augen aufzuschlagen und zu bellen, wenn man ihn streichelt.
Der Mensch trifft Entscheidungen und übernimmt Verantwortung. Bestenfalls.
Auch Androiden sind einsam. Die letzten drei haben sich bei „Spatzenhirn“ John Isidore in einem verlassenen Haus einquartiert. Isidore ist glücklich. Er ist nicht mehr allein. Er weiß durchaus, mit wem er es zu tun hat. Seine neuen Freunde sind auf der Flucht, sie sind so unerwünscht wie er, aber er kann ihnen helfen, sie verstecken, sie schützen, wenn es sein muss.
Er ist bereit, sich selbst zu opfern. Plötzlich scheint er der einzige wahre Mensch zu sein. In dem heruntergekommenen Haus findet er eine Spinne. Eine Spinne! Eine echte, lebende Spinne! Die Androiden schneiden der Spinne die Beine ab. Unfähig, sich in andere Wesen hineinzuversetzen, können sie böse und gefährlich sein. Rick Deckard findet und erschießt sie.
Androiden sind keine wehrlosen, unschuldigen Opfer (oder vielleicht doch: Sie sind so programmiert); sie sind Kampfmaschinen oder anders ausgedrückt autonome Waffensysteme. Im Hinblick darauf sagte der frühere NATO-Generalsekretär Rasmussen: „Wir sprechen nicht über eine Zukunftsvision. Die militärische Nutzung Künstlicher Intelligenz steht unmittelbar bevor.“
Um das klar zu machen: KI ist nicht „böse“. Ihre Software schreibt sich selbst fort, ist also lernfähig. Bei den sogenannten „Killer-Robotern“ entscheidet sie aber aufgrund von Algorithmen und ohne menschliches Zutun, ob und wer getötet wird. Die ethischen Fragen, die sich hier auftun und die dringend einer Diskussion bedürfen, sind u. a. die nach Entscheidung und Verantwortung.
Ridley Scotts Film aus dem Jahr 1982 entscheidet sich übrigens für ein von der Buchvorlage abweichendes Ende. Bei ihm zeigen die Androiden Trauer über den Verlust von ihresgleichen, also Mitgefühl, und Rick Deckard brennt mit einer Androidin durch. Ist Deckard ein Mensch oder ein Android? Das ist ungewiss, aber er scheint ein Mensch zu sein, wenn Menschsein bedeutet, nicht nur für Tiere, sondern auch für Androiden Mitgefühl zu entwickeln, für alle Wesen, lebendig im überkommenen Sinne oder nicht. Gleichzeitig schließt ihn diese Haltung aus der Gemeinschaft der Menschen aus, die alles nichtmenschliche Leben zum Abschuss freigegeben hat. Hier setzt der Film „Blade Runner 2049“ von Denis Villeneuve an, der Ende 2017 in die Kinos kam. Die Süddeutsche Zeitung attestierte ihm, „nicht nur die richtigen Fragen zur Zukunft des Menschen und seiner Maschinen“ zu stellen, sondern sie auch „mit hypnotischen Bildern“ zu beantworten.
„Blade Runner“ ist nicht so sehr ein Science-Fiction-Abenteuer (das ist nur der Vorwand), sondern ein philosophischer, moralischer und ethischer Durchlauf, ein Roman der Fragestellungen und der Ideen. Die Grundstimmung ist die des metaphysischen Ausgesetztseins. Die Frage heißt nicht „Wie geht die Geschichte aus?“, sondern „Wer bin ich?“.
Literaturhinweis
- Philip K. Dick, Blade Runner (Do androids dream of electric sheep), Fischer TB 2017
- Ridley Scott, Blade Runner. Film von 1982
- Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Film von 2017
- buddhistische Trauerzeremonie für AIBO-Hunde unter „aibo funeral“ im Netz
- über „Blade Runner 2049“ SZ Nr. 228 vom 04. Oktober 2017
Hat dir dieser Artikel gefallen?
Bestelle diese Ausgabe oder abonniere ein Abo. Viel Inspiration und Freude beim Lesen.


